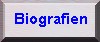Preußen unter Dampf gesetzt
Der gebürtige Neuruppiner Karl Friedrich Bückling läutete damit das Industriezeitalter in Preußen ein
Der gebürtige Neuruppiner Karl Friedrich Bückling läutete damit das Industriezeitalter in Preußen ein
NEURUPPIN - Die Briten sind für ihre Höflichkeit berühmt. Auch James Watt wollte dem Ruf seiner Landsleute in nichts nachstehen, als er eine Anfrage zweier im Land weilender Preußen erhielt: Ob er ihnen nicht einmal seine Erfindung zeigen könne? Watt lud die Herren Jakob Freiherr Waitz von Eschen und Karl Friedrich Bückling auf eine Tour durch seine Fabriken in Soho und Birmingham ein.
Dort zeigte er ihnen stolz seine neuartige Dampfmaschine und plauderte über diese Erfindung. Was Watt nicht ahnte: Er hatte es mit zwei Spionen zu tun. Einen Tag, nachdem sie in Watts Hause sogar gespeist hatten, fuhren die beiden noch einmal in die Fabrik, bestachen einen Arbeiter, damit er ihnen die Maschine in allen Einzelheiten auseinander baute und Bückling Zeichnungen machen konnte.
Karl Friedrich Bückling entstammt einer alteingesessenen Neuruppiner Kaufmannsfamilie. Am 23. August 1756 wurde er in Neuruppin geboren. Den Jungen interessierten technische Dinge mehr als Vaters Geschäft, das zwischenzeitlich nach Berlin gewechselt war. Dort machte Bückling eine Lehre als Brückenbauer, wechselte später aber ins Berg- und Hüttenwesen. Mit einem Studium in Freiberg schloss er unter anderem mit dem Problem Bekanntschaft, das das Vordringen in tiefe Stollen mit sich brachte: steigendes Grundwasser. Es abzupumpen, war aufwendig. Die Kraft des Menschen und der Pferde waren begrenzt. Deshalb hatte Preußen schon lange ein Auge auf die Feuermaschinen geworfen, die in England für Pumpenantrieb gebräuchlich waren.
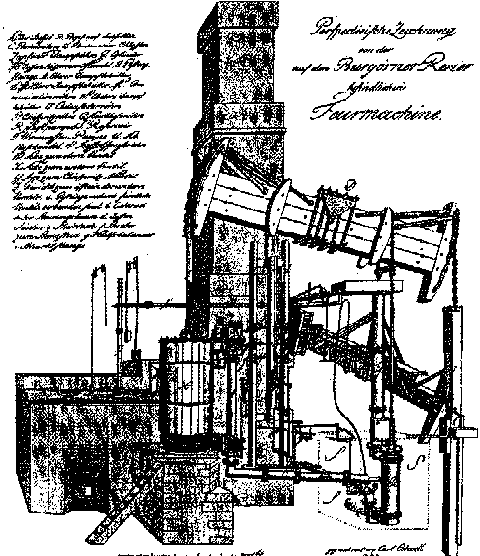
Die enorme Verbesserung durch Watts Erfindung des Kondensators war auch bis zum Bergbauminister Heinitz vorgedrungen. Der wollte diese technische Neuerung unbedingt haben. Doch der Erfinder, James Watt, und sein Geldgeber, Matthew Boulton, wollten im Gegenzug, dass für 14 Jahre nur Dampfmaschinen aus ihren Fabriken in Preußen laufen. Das würde gegen das marktpolitische Prinzip des Königs zuwider laufen, stets mehr aus- als einzuführen. Deshalb konnte Heinitz Friedrich II. leicht zur üblichen Praxis der Industriespionage überreden. Den Auftrag bekam der erfahrene Oberbergrat Waitz von Eschen. Und der durfte seinen fähigsten, gerade mal 22-jährigen Bauinspektor Bückling mit nach England nehmen.
1779 erreichten sie Preußen mit Bücklings Zeichnungen in der Hand. 1783 hatte er ein Modell fertig. Dass es gar nicht perfekt funktionierte, interessierte am Rande. "Der Minister jubiliert über seine Feuermaschine", schreibt Bergbaustudent und nachmalige leitende Minister Preußens Karl von und zum Stein seinem Lehrer in einem Brief.
Der preußische Hof bewilligte 1783 das Geld für den Bau einer Maschine in Hettstedt am Rande des Ostharzes. Bückling bekam die Oberaufsicht über das Projekt - beileibe keine einfache Aufgabe. Einerseits war immer noch unsicher, ob seine Zeichnungen genau genug waren. Viel schwerer wog aber, dass die Materialbeschaffung im Agrarstaat Preußen weitaus ungünstiger waren als im vorindustriellen England. Es gab nicht mal genug Koks zur Befeuerung. Bückling gelang es jedoch, mit Beharrlichkeit alle erforderlichen Materialien und Geräte zusammen zu bekommen.
Bereits zwei Jahre später stand in Hettstedt die erste Dampfmaschine. Bückling lud Heinitz und die preußischen Oberbergräte zu seinem 29. Geburtstag in seine Werkstatt nach Hettstedt ein, der ersten Demonstration beizuwohnen. Heinitz war begeistert. Schon vorher hatte er Bückling einen "zweiten Erfinder der Dampfmaschine" genannt. Nachdem er sich vom Lauf der Maschine überzeugt hatte, bot er ihm nicht nur eine Gehaltserhöhung, sondern gleich eine Monopolstellung für den Vertrieb dieser Maschinen in Preußen an.
Doch was Heinitz nicht wusste: Bückling hatte bewusst nur kurz seine Maschine in Betrieb gehalten. Anfangs funktionierte sie immer .recht gut. Doch nach einer Weile geriet sie immer ins Stocken. Ventile waren dann offen, wo sie geschlossen sein sollten, oder schlossen sich, wenn sie nicht durften - und die Maschine wurde abgewürgt. Die ganze Steuerung funktionierte nicht. Angesichts der investierten Unsumme ein Fiasko.
Bückling bekam die Gelegenheit, auf einer zweiten Reise nach England erfolgreich zu versuchen, was auf der ersten noch misslungen war: mit viel Bestechungsgeld einen englischen Ingenieur abzuwerben. Es gelang. Mit William Richards folgte ihm einer von Boultons Arbeitern nach Preußen. Doch auch dessen Hilfe blieb anfangs ohne Früchte. Die Steuerung funktionierte zwar prächtig. Doch entpuppte sich das Material als zu verschleißanfällig. Selbst Heinitz riss jetzt der Geduldsfaden. Bückling hatte oft genug, so 1784 vor französischen Journalisten, mit seinem Coup geprahlt: Er hätte der Wattschen Erfindung noch neue Ideen hinzugesetzt, und sie würde über 100 Pferde ersetzen. Und jetzt drohte der Lieblingsuntertan bei Heinitz für immer in Ungnade zu fallen. Doch Bückling zog den Kopf noch aus der Schlinge. Denn wieder gelang es ihm, eine fähige Firma ausfindig zu machen, die die Materialprobleme lösen konnte. Danach arbeiteten die Pumpen einwandfrei. Das Aufatmen war groß. Bücklings Beharrlichkeit machte sich endlich bezahlt. Denn die Einsparungen, die das Pumpen mit seiner Dampfmaschine machten, waren beträchtlich. Bückling bekam 1788 den Auftrag, eine nun doch aus England importierte Dampfmaschine in Schlesien zu montieren und in Betrieb zu nehmen.
1790 erhielt er von Heinitz den Titel Oberbergrat. Danach gab es auch Zeit fürs Private. Er heiratete und gründete eine Familie, aus der zwei Kinder hervor gingen. Sein Sohn Adolf trat später einmal in seine Fußstapfen und wurde ebenso Oberbergrat. Für sich und seine Familie kaufte er das Schloss Mansfeld. Bücklings Revier war das Mansfelder Land - dort, wo er die erste Dampfmaschine Wattscher Bauart in Preußen nachgebaut hat. Zusammen mit Richards baute er bis 1806 neun weitere Maschinen für den heimischen Bergbau. Seine Werkstatt wurde Pilgerstätte für viele preußische Studenten, die sich dort über die Technik des Wunderwerks schulen ließen. Doch die Gesundheit machte dem Lehrmeister bald einen Strich durch die Rechnung. Als 1834 seine Bibliothek versteigert wurde, war enorm viel religiöse Erbauungsliteratur darunter. Vielleicht hat sich Bückling häufig darin vergraben, bis er am 22. Februar 1812 seiner langen Krankheit erlag.
Bildunterschrift: Die Hettstedter Dampfmaschine: Bückling baute einige Jahre an ihr und scheiterte fast an ihrer Komplexität. Quelle: Zur Geschichte der ersten deutschen Dampfmaschine
15.11.2006, Ruppiner Anzeiger, Christian Schönberg